Thematischer Stammtisch
Hochwasserrisikomanagement als Instrument zum Schutz von Menschenleben und Lebensgrundlagen
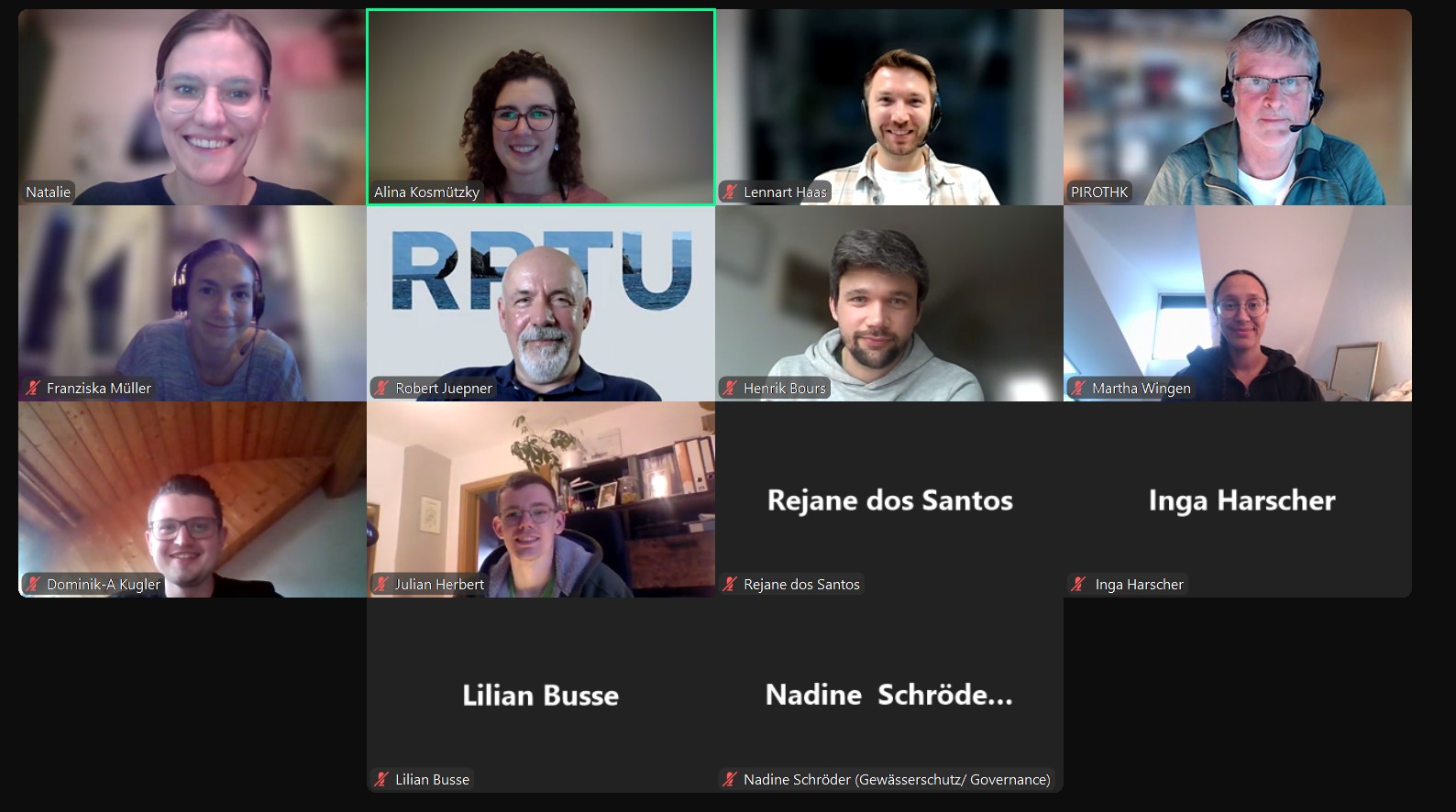
Am 17.04.25 erhielten 14 Teilnehmende des Thematischen Stammtisches umfassende Einblicke in die Tätigkeiten des Fachausschusses HW-4 „Hochwasserrisikomanagement“. Dr.-Ing. Klaus Piroth (CDM Smith) und Prof. Dr. Robert Jüpner (RPTU Kaiserslautern) berichteten praxisnah den Studierenden, Teilnehmenden aus diversen Planungsbüros, Kommunen und Behörden von den Aufgaben und Arbeitsbereichen der zwölf Arbeitsgruppen des Fachausschusses.
Diese beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten des Hochwasserschutzes und Hochwasserrisikomanagements. Die Zahl und Themenbreite der Arbeitsgruppen zeigt deutlich die Komplexität des Feldes und reicht von eher technisch ausgerichteten Themen bis hin zur Resilienz. Im Zentrum der Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements stehen immer der Schutz von Menschenleben und die Minderung von Schäden bei Hochwasser, insbesondere bei den sehr seltenen Ereignissen. Hierin liegt die besondere Herausforderung und hier unterscheidet sich auch die Arbeit im Vergleich zu anderen Fachausschüssen.
Einige Arbeitsgruppen arbeiten an der Verbesserung der Risikokommunikation, der Überarbeitung von Praxisleitfäden zu Starkregen und der Entwicklung dezentraler Maßnahmen zur Hochwasserminderung. Andere Gruppen konzentrieren sich auf die Ausbildung von Auditoren für das Hochwasseraudit, die Erstellung eines Themenheftes zu Hochwasseralarm- und Einsatzplänen sowie die Bewertung von Hochwasserschäden. Es gibt auch Arbeitsgruppen, die sich mit der Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten und der Erstellung von Starkregen- und Hochwassergefahrenkarten befassen.
Sowohl Klaus Piroth als auch Robert Jüpner ermutigen junge Expertinnen und Experten dazu, ihr Wissen in Arbeitsgruppen einzubringen und weisen auf das Erfordernis der Überarbeitung mehrerer Arbeits- und Merkblätter aufgrund der rasanten Entwicklung und Erkenntnisgewinne der letzten Jahre hin. Hierbei sind ausdrücklich nicht nur Ingenieursdisziplinen gefragt. Im Bereich des Hochwasserrisikomanagements kommt es auch auf die Sichtweise und Expertise bspw. des Katastrophenschutzes (THW, Feuerwehr, Hilfsorganisationen etc.) oder der Sozial- und Gesellschaftswissenschaften (Risikokommunikation) an. Dennoch ist es wichtig, wissenschaftliche Begleitung bei Wiederaufbauprozessen zu gewährleisten und die Modellierung von Hochwasser zu verbessern, um zukünftig u. a. auch den Materialtransport zu berücksichtigen, der häufig zu unkalkulierbaren Überflutungen führt.
Das Stichwort Resilienz taucht im Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement sehr häufig auf. Dabei gibt eine Vielzahl verschiedener Ansätze zur Interpretation von Resilienz und der Entwicklung resilienter Lösungsansätze. Im besten Fall führt Resilienz nicht nur zu einer Rückgewinnung des Ausgangszustandes, sondern zu einer Verbesserung des vorherigen Systemzustandes. Grundsätzlich soll der Wiederaufbau nach Hochwasserereignissen bestenfalls risikoangepasst und resilienzsteigernd erfolgen, damit zukünftige Schäden minimiert und Menschenleben gerettet werden können.
Der Fachausschuss Hochwasserrisikomanagement leistet wichtige Arbeit in verschiedenen Bereichen des Hochwasserrisikomanagements, um die Hochwasservorsorge und Hochwasserbewältigung nachhaltig und effektiv zu verbessern und weiterzuentwickeln. Es gibt viele Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten, die eine kontinuierliche Unterstützung und Mitarbeit erfordern.
Alina Kosmützky, Natalie Lübbers Junge DWA Circle Stammtische


Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
+49 2242 872 333 +49 2242 872 100 info@dwa.de