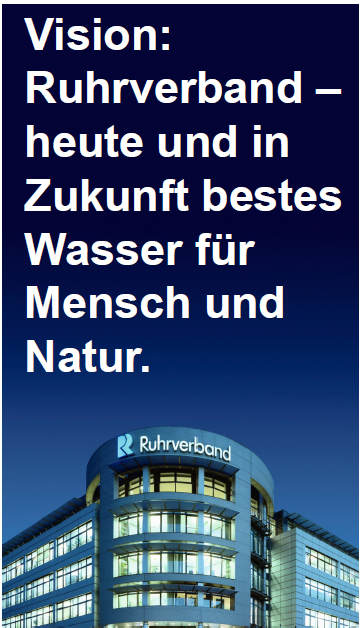Der Klimawandel ist nicht mehr umkehrbar. Um die Erderwärmung nicht weiter in die Höhe zu treiben, müssen jetzt dringend umfassende Klimaschutzmaßnahmen (Reduktion von Treibhausgasen) umgesetzt werden. Da der Klimawandel nicht mehr umkehrbar ist, heißt das aber auch, Klimaextreme werden uns auf Dauer begleiten. Hierfür sind Anpassungsstrategien dringend notwendig.
Die DWA möchte mit diesem Preis ausschließlich bereits realisierte Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz mit Leuchtturmcharakter auszeichnen. Ganz wichtig hierbei ist, dass das gute Beispiel und die damit verbundenen Maßnahmen geeignet sein müssen, auch in anderen Regionen oder Siedlungen realisiert zu werden. Um den DWA-Klimapreis sollen sich die Träger der jeweiligen Maßnahme bewerben.
Klimapreis 2025 – Die Gewinner
Stadt Herten – Der Park kommt in die Stadt
Mit dem Projekt „Der Park kommt in die Stadt“ gewinnt Herten den DWA-Klimapreis 2025. Herten überzeugte mit der klimaangepassten Umgestaltung der Innenstadt. Eine vormals versiegelten Innenstadtstraße wurde in einen grünen, lebendigen Stadtraum verwandelt. Ein unterirdischer Speicher ermöglicht die nachhaltige Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung, während Wasserspiele und Begrünung die Aufenthaltsqualität deutlich steigern. Die Maßnahme entlastet das Mischwasserkanalsystem bei Starkregenereignissen und ist ein herausragendes Beispiel für die wasserbewusste Stadtentwicklung. Das Projekt kombiniert auf herausragende Weise die notwendige Anpassung an den Klimawandel mit einer Verschönerung des Stadtbildes und der Steigerung der Lebensqualität.
Klimapreis 2025 – 2. Platz
Göttingen – Starkregenvorsorge mit der Bevölkerung
Die Göttinger Entsorgungsbetriebe und die Stadt Göttingen unterstützen mit viel Engagement Grundstückseigentümer beim Schutz vor Überflutungen durch Starkregen. Die Göttinger Entsorgungsbetriebe bieten seit März 2023 ein kostenloses Beratungs- und Informationsangebot sowie eine interaktive, webbasierte Starkregengefahrenkarte an. Über 600 Beratungen seit Projektstart belegen die hohe Akzeptanz des Projektes in der Stadt. Die DWA vergibt für dieses innovative Projekt zur Klimaanpassung den zweiten Platz des DWA-Klimapreises an Göttingen.
Klimapreis 2025 – 3. Platz
TU Darmstadt – Regenwasserbewirtschaftung und nachhaltige Nutzung
Die Technische Universität Darmstadt kombiniert innovatives Regenwassermanagement am Campus Lichtwiese mit wissenschaftlicher Forschung. Die intelligente Kombination aus Versickerung, Brauchwassernutzung und Begrünung verbessert das Mikroklima, fördert die Grundwasserneubildung und schafft zugleich ein Naherholungsgebiet für Studierende und Anwohnende. Das Projekt ist zudem Teil eines Forschungsansatzes zur künstlichen Grundwasserneubildung und wird vom Fachgebiet Hydrogeologie wissenschaftlich begleitet. Im „Living Lab“ werden kontinuierlich Daten zur Wasserqualität und zum Grundwasserspiegel gesammelt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen der weltweiten Grundlagenforschung zur Trinkwasserbereitstellung. Die DWA prämiert das Projekt Campus Lichtwiese mit dem dritten Platz beim DWA-Klimapreis 2025.
Schirmherr Sven Plöger
"Wir müssen wieder mehr Respekt gegenüber der Natur erlernen, denn dieser Planet braucht nicht uns, sondern wir ihn!"
Sven Plöger „wettert“ seit mehr als zwei Jahrzehnten in der ARD und den dritten Programmen. Für den studierten Meteorologen rückt unser Klima immer mehr in den Mittelpunkt – denn Klimawandel bedeutet extremeres Wetter mit oft tragischen Folgen. Das komplexe Thema für jede und jeden zu übersetzen, ist ihm ein großes Anliegen.

Die Nominierten
Klimapreis 2025
Hier finden Sie die nominierten Projekte in diesem Jahr.
Die Preisverleihung fand am 15. September 2025 im Rahmen der WasserTage in Berlin statt.
Urban Wetlands - Neue Hauptverwaltung nach dem Schwammstadtprinzip
In der Siedlungswasserwirtschaft gilt das Prinzip der sogenannten Schwammstadt zunehmend als konsensfähige Strategie für eine wassersensible und klimafolgenangepasste Stadtentwicklung. Die Schwammstadt zielt darauf ab, Regenwasser zu sammeln, zu speichern und wiederzuverwenden und auf diese Weise klimawandelbedingten vermehrten Starkregenniederschlägen und Trockenpe-rioden entgegenzuwirken. Multifunktionale Flächen, wie die in 2024 fertiggestellten Wetlands auf dem Gelände der Hauptverwaltung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, sind ein Beispiel für eine solche Maßnahme. Im Rahmen der Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes wurden die Wetlands auf einer bereits vorhandenen Parkplatzfläche integriert. Sie stellen eine naturnah ge-stalte Grünfläche dar, die das Regenwasser der umliegenden Dach- und Parkplatzflächen auf-nimmt und anschließend versickert oder verdunstet. Gleichzeitig dient der Bereich durch integrierte Sitzmöglichkeiten als Aufenthalts- und Erholungsort für die Mitarbeitenden des Unternehmens.
Bredenbek - Stützen des Wasserhaushalts (im Wald)
Die auf Sommerkühle angewiesenen Lebensgemeinschaften unsere Bäche benötigen Hilfe. Gewässerrevitalisieren, jegliche Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel, Rückhalt des Ab-flusses, Stärken der ortsnahen Versickerung sind Beispiele. Dies ist bedeutsam, da Bäche und kleine Flüsse ca. 80 % unserer Fließstrecken stellen. Am Moränenbach Bredenbek, Kreis Segeberg, bietet der GPV Alster-Rönne mit Kies Hilfen, durch Anheben übertiefter Gewässersohle so-wie durch wasserrückhaltendes Strukturgeben des Niedrig- und Mittelwasserprofils. Dies findet statt im FFH-Forst Endern, wo alte Mäander durch initiative Kiesgaben reaktiviert werden sowie durch instream-Restaurieren in der folgenden Agrarlandschaft. Im Wald werden durch wechselnde Feuchte in Tieflagen Entwicklungen zum Naturwald provoziert. Buchen stürzen, „Bach-Bäume“ wie Erlen siedeln sich an, Flächen erhalten ihre Multifunktionalität zurück. Der Bach in der Agrarlandschaft, Erlenbestanden, wird in seiner Funktion als Forellenregion wirksam.
Starkregenvorsorge in Göttingen
Die Stadt Göttingen und die Göttinger Entsorgungsbetriebe haben es sich zur Aufgabe gemacht, Grundstückseigentümer*innen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Ziel ist es, Grund-stücke und Privatgebäude in Göttingen so effektiv wie möglich vor Starkregenfolgen zu schützen und zur privaten Eigenvorsorge zu motivieren. In Zusammenarbeit mit den Göttinger Akteuren aus den Bereichen Straßen- und Wasserbau, Nachhaltige Stadtentwicklung, den Göttinger Entsor-gungsbetrieben sowie den Grundstückseigentümer*innen stellt dieses Projekt ein praxisnahes Bei-spiel für die kommunale Gemeinschaftsaufgabe des Überflutungsschutzes dar. Dieses Konzept beinhaltet eine ausführliche Wissensübermittlung der wichtigsten Aspekte von Starkregen und wird mit den Bausteinen „informieren“, „beraten“ und „fördern“ angeboten.
Klimaangepasste Innenstadtgestaltung in Herten
Im Zuge der Umgestaltung nach dem Gestaltungskonzept „Der Park kommt in die Stadt“ haben die Ewaldstraße und der Place d’Arras eine hohe Aufenthalts- und Gestaltungsqualität erhalten und wurden durch verschiedene Maßnahmen ökologisch aufgewertet. Hierzu zählen u.a. eine umfangreiche Entsiegelung und Begrünung, ein nachhaltiger Umgang mit Regenwasser sowie die Schaffung attraktiver Spiel- und Sitzelemente. Insgesamt führt der gesamte Umbau zu einer Verbesserung des lokalen Klimas, da die realisierten Maßnahmen (Begrünung, Entsiegelung, helle Pflasterung, Wasserspiel) zu einer Abkühlung der Fläche führen. Weiterhin wird die ortsnahe Versickerung durch Grünbeete und Rasenfugenpflaster gefördert. Dank des innovativen Bewässerungssystems (Regenwasserspeicher) wird kein Regenwasser verschwendet und für eine nachhaltige Bewässerung der Pflanzen gesorgt. Dank der neuen Fernwärmeleitung wurde eine emissionsarme und klimaschonende Wärmeversorgung der angrenzenden Haushalte ermöglicht.
Roadmap Krisenhochwasser
Die „Roadmap Krisenhochwasser“ ist ein strategisch-operationelles Programm zur Klimaan-passung, das Maßnahmen zur Bewältigung von Starkregen- und Hochwasserereignissen in Krisensituationen umsetzt. Sie wurde entwickelt, um eine zukunftsfähige, gegen Überflutungs-gefahren klimaresiliente Gesellschaft zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Trägern öffentlicher Belange, Einsatzkräften und der Bevölkerung zu verbessern. Die Roadmap umfasst Präventionsstrategien, Frühwarnsysteme sowie Notfallpläne, um die Auswirkungen der immer intensiver werdenden Flutereignissen zu minimieren. Sie betont die Bedeutung eines holistischen Ansatzes mit einer vorausschauenden Planung, naturbasierten Lösungen, robuster Infrastruktur, Risikokommunikation und effizientem Krisenmanagement. Ziele sind der Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung sowie die Minimierung von Umwelt- und Sachschäden. Mit der parallelen Initiierung zahlreicher Projekte handeln EGLV mit ihr vor dem Eintreten von Extremhochwasser.
Regenwasserbewirtschaftungsanlage
Die TU Darmstadt hat sich zum Ziel gesetzt, für die solitäre Gesamtanlage Campus Lichtwiese ein effektives und intelligentes System zur Regenwasserbewirtschaftung zu etablieren. Nahezu 100 % des anfallenden Niederschlags aus den Liegenschaften und Außenanlagen sollen am Standort zu-rückgehalten und versickert werden. Im Rahmen eines Grundwassermanagements kann ein Teil des versickerten Regenwassers ressourcenschonend als Brauchwasser zum Einsatz kommen. Damit wird verschiedensten klimatischen Szenarien präventiv begegnet, z.B. länger anhaltenden Trockenphasen, erhöhter Hitzebelastung und punktuellen Starkregenereignissen bzw. Dauerre-gen. Infolgedessen kann das städtische Kanalsystem entlastet und zum Überflutungsschutz beige-tragen werden. Die Grundwasserneubildung wird gefördert und das Mikroklima des Campus und Naherholungsraums Lichtwiese positiv beeinflusst. Mit der Gewinnung des Brauchwassers können Kühlanlagen versorgt, Grünanlagen bewässert oder Sanitäranlagen gespeist werden.
Hochwasser- und Starkregenfrühwarnung (HoWa-innovativ und HoWa-Pro)
In „HoWa-innovativ“ wurde ein neuartiges niederschlagsbasiertes Hochwasserfrühwarnsystem unter Verwendung von Dämpfungsdaten kommerzieller Mobilfunknetze entwickelt und in HoWa Pro einsatzreif weiterentwickelt. Das neue Frühwarnsystem setzt die Daten schon vorhandener Infrastrukturen – hier Regenradare des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und Richtfunkstrecken der Mobilfunkanbieter (CML) für die Daseinsvorsorge in Wert. Diese opportunistisch genutzten Daten werden durch künstliche Intelligenz (KI) hochinnovativ für eine völlig neue Anwendung des Zivilschutzes und der Klimaanpassung eingesetzt.
Klassische Hochwasservorhersagen erlauben meist keine rechtzeitige Hochwasserwarnung in kleinen und schnell reagierenden Fließgewässern. In „HoWa-innovativ und Pro“ wurde deshalb eine räumlich wesentlich präzisere Vorhersage von Hochwasser und Starkregen unter Nutzung innovativer Niederschlagsmess- und Vorhersageverfahren mit dem Fokus auf kleinere Flusseinzugsgebiete bis 1.000 km² entwickelt. Diese Einzugsgebiete sind mit steigender Tendenz u.a. durch Sturzfluten infolge Starkregen mit verheerenden Folgen betroffen (z.B. 2024; 2021 - Ahr: ca. 900 km²; 2002 - Müglitz: ca. 200 km²).
Diese neu entwickelte Generation von Hochwasservorhersagesystemen ermöglicht auf Basis der zusätzlichen Niederschlagsinformationen in Verbindung mit probabilistischen Ensemble-Wettervorhersagen des DWD erstmals Frühwarnungen mit bis zu 48 Stunden Vorwarnzeit. Diese international einzigartige Technologie wurde mit einem auf die Anforderungen der Katastrophenwarnung und -abwehr zugeschnittenen Demonstrator ca. 2 Jahre erfolgreich getestet. So konnte zum Hochwasser 2021 bereits vor der DWD-Unwetterwarnung in Sachsen vor Hochwasser und bereits eine Woche vor dem Septemberhochwasser 2024 gewarnt werden. Im fast beendeten Folgeprojekt HoWa-Pro wurde das System zur allgemeinen Einsatzreife entwickelt und mit einem Schulungsprogramm ergänzt.
Quartier LÜCK, naturstrom AG
Aus Abwasser Wärme gewinnen. Was bisher in Deutschland noch kaum genutzt wird, ist im Quar-tier LÜCK in Köln-Ehrenfeld ab 2025 Alltag. Die Hauptenergiequelle liegt nur wenige Meter außer-halb des Quartiers. Ein Wärmetauscher entzieht dort dem Abwasser Wärmeenergie und liefert diese an die Wärmepumpe in der Heizzentrale. Photovoltaik auf den Dächern liefert Ökostrom für die Heizungsanlage.
Die fossilfreie Energieversorgung des Quartiers erfüllt damit schon heute unsere Klimaschutzziele für 2045 und spart jährlich 107 Tonnen CO2 (Äquivalente) im Vergleich zur Versorgung mit Netz-strom und einem Gaskessel ein. Die wvm Gruppe realisiert das Quartier mit 216 Wohnungen und einem Kindergarten. Als Contractor verantwortet die naturstrom AG den energetischen Vorbildcha-rakter des Projekts. Sie übernimmt neben der Planung und Errichtung auch den Betrieb des Ener-giesystems. Ermöglicht wird die Nutzung der Abwasserwärme durch eine enge Zusammenarbeit mit den Stadtentwässerungsbetrieben Köln, AöR.

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
+49 2242 872 333 +49 2242 872 100 info@dwa.de